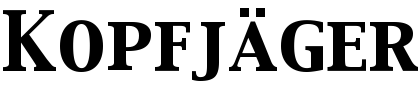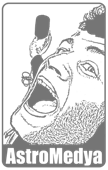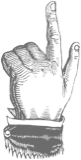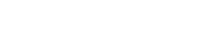Johann Wolfgang Goethe
-
* 28. August 1749 in Frankfurt a. M.
-
† 22. März 1832 in Weimar

Goethe und die Naturwissenschaften
Neben der Dichtkunst interessierte Goethe sich sehr für die Naturwissenschaften. Bekannt wurde vor allem seine Farbenlehre und sein Fund des Zwischenkieferknochens. Auch die Physiognomie Lavaters und die Phrenologie Galls hatten es dem Dichterfürsten angetan. In privaten Studien ließ sich Goethe das Präparieren von Knochen und Schädeln beibringen. In seinem Haus erhielt er von Joseph Gall persönlich Unterricht in die Lehren der Phrenologie und arrangierte gesellige Nachmittage mit Freunden, in denen er zur Belustigung der Anwesenden Köpfe vermaß und analysierte. Zudem besaß er eine bemerkenswerte naturkundliche Sammlung, zu der auch eine Reihe von Schädelabgüssen zählte.
Goethe und die Frauen
Goethe liebte die Frauen bis ins hohe Alter. Die Eheschließung mit Christiane Vulpius aber geschah aus einer politischen Not heraus und die Beziehung zu ihr war vor und nach der Vermählung in hohem Maße unkonventionell. Goethe war es gewohnt um die Frauen, die er liebte, offen zu werben. Als er sich jedoch in die blutjunge Ulrike von Levetzow verliebt und als 73 jähriger Greis um ihre Hand anhält, muss er die wohl erschütternste Niederlage seines Liebeslebens erleiden. Er erhält nicht einmal eine Absage.
Goethe und der Tod
Für seine Angst vor dem Tod war Goethe schon zu Lebzeiten bekannt. Es verwunderte daher kaum, dass er an der Beerdigung Schillers 1805 und an der Gedenkzeremonie 20 Jahre später nicht teilnahm. Auch die Besuche bei seiner sterbende Frau Christiane mied er in den letzten Wochen ihres Lebens.
Warum Goethe dennoch den Schädel Schillers zu sich nach Hause holte und eine solche Faszination für die Erforschung menschlicher und tierischer Überreste entwickelte, bleibt letztlich ein psychologisches Rätsel.


zuletzt geändert am 9. Mai 2009
Bei Fragen zu dieser Seite schreiben Sie uns bitte an info@astromedya.de